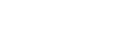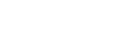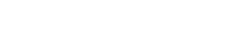Bergbahnen: Entwicklungstrends und Spannungsfelder 2040
Von Zeit zu Zeit ist es ratsam den Blick vom operativen Tagesgeschäft zu lösen, Abstand zu gewinnen und sich mit grundlegenden Entwicklungstrends und Spannungsfeldern der Seilbahnwirtschaft zu beschäftigen. Bergbahnen wohin – 2040? Nachfolgend unsere Reflexionen zur künftigen Entwicklung ohne eine Vollständigkeit in der Kürze dieser Kolumne zu beanspruchen:
Reflexion Wachstum:
Wintersportgebiete immer grösser, höher und weiträumiger verbunden? Stetiges Wachstum der Ersteintritte? Oder ist statt Quantität doch eher ein qualitatives Wachstum nach innen anzustreben? Grösse steigert oft die Resilienz und Professionalität der Unternehmen macht sie aber andererseits auch komplexer und schwerfälliger. Was, wenn ein Bergbahnunternehmen «to big to fail» für eine Region und Land wird? Die Seilbahnwirtschaft läuft Gefahr, mit Wachstum und Grösse letztlich auch stärker reguliert und überwacht zu werden.
Reflexion Finanzierung:
Je grösser, globaler und dominanter die Unternehmen, desto höher die Erwartung im Markt ohne Subventionen und öffentlicher Unterstützung auszukommen. Mehr unternehmerische Selbstverantwortung und Risikokapital für angestrebte, mutige Investitionen sind notwendig. Private Aktionäre erwarten entsprechende Dividenden und Erfolg und Seilbahnen werden am Kapitalmarkt abgestraft, wenn dies nicht der Fall ist.
Reflexion Nachhaltigkeit:
Das 3-Säulen-Modell hat die reine ökonomische Marktwirtschaft mit sozialer und ökologischer Verantwortung verknüpft und zu neuen spannenden Geschäftsmodellen geführt. Klimaneutrale Entwicklung ist die oberste Verpflichtung der kommenden Jahrzehnte auch für die Seilbahnwirtschaft und Tourismus insgesamt. Nicht das ökonomisch Machbare, sondern das ökologisch Tragbare wird sich durchsetzen.
Reflexion Raumplanung:
Betrachtet man die Entwicklung der Winterdestinationen im Alpenraum, stellt man fest, dass immer mehr kleinere Wintersportgebiete in tieferen Lagen verschwinden und Destinationen in höheren Lagen sich zu grösseren Destinationen zusammenschliessen. Welche Raumkonzepte sind für die künftige Entwicklung anzustreben? Konzentration auf wenige Grossregionen oder doch eher dezentrale, auf Höhenlage und Mobilitätsstrukturen optimierte Erlebnisräume in den Alpen?
Reflexion Massentourismus:
Soziale Medien, günstige Mobilität und globalisierte Reiseströme bewegen immer breitere Gesellschaftsschichten weltweit: «hot spots» ächzen unter dem Dichtestress des Massentourismus! Auch der Alpentourismus ist zunehmend davon betroffen. Gegenreaktion sind individualisierte Erlebnisse in unberührte Natur, Glamping, Alpinismus, Tourenski und Schneeschuh Trails mit negativen Folgen für Biodiversität und Wildlife. Die Angebote flüchten selbst in die Nacht mit Starlight-Angeboten und Nachtwanderungen.
Reflexion Arbeitswelt:
Der Arbeitsmarkt scheint aus den Fugen zu treten: durch demografischen Wandel, Bildungssystem und Wertewandel sind Arbeitsplätze im Tourismus immer schwieriger zu besetzen. Die Ansprüche an die Arbeitswelt steigen und damit auch die Lohnkosten. Dies führt zu höherer Selbstbedienung in der Servicekette, Digitalisierung und Substitution durch KI-Anwendungen. Wie begegnen wir der Gefahr einer Servicewüste, steigender Migration ausländischer Arbeitskräfte und Identitätsverlust der verbleibenden Einheimischen?
Reflexion immersiver Erlebnisse:
Werden die Alpen durch immersive Erlebnisse, d.h. Verschmelzung digitaler (VR/AR) und realer Aspekte zu einem grenzenlosen Sinneserlebnis durch Raum und Zeit? Von Wanderungen und Zeitreisen durch verschiedene Klimaphasen der Erdgeschichte bis hin zu künstlichen Phantasiewelten von Disney. Indoor verschmilzt mit Outdoor und umgekehrt. Erkennen wir die Chancen und Risiken einer solchen Tourismusentwicklung? Wird das Reisen – auch aus ökologischen Gesichtspunkten – gar zu einem gewissen Grad substituiert?
Reflexion Pricing:
In den vergangenen Jahrzehnten reisten wir immer häufiger, kürzer und weiter. Wohlfahrt und günstige Mobilität förderten die globale Erreichbarkeit. Wird sich dies fortsetzen oder wird durch steigende Gebühren, Taxen und Steuern sowie Kostenentwicklung der Tourismus für die Mittelschicht weniger attraktiv und erschwinglich? Wird der Preisdruck im Ticketing und Skiabos anhalten oder kommt es eher zu einem globalen Upgrading in ein Premium Segment?
Reflexion Kunden:
Keine Zukunft ohne Kunden! Kennen wir die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen und Personas in unseren Destinationen wirklich? Integrierte Datenmodelle über die ganze Servicekette erlauben immer bessere Einblicke in das Kundenverhalten. Quantencomputer und KI werden uns den gläsernen Kunden offenbaren. Doch: kennen wir den dynamischen Wandel und wie beantworten wir widersprüchliche Erwartungen in der Gestaltung unserer Erlebnis- und Servicequalität?
In der Politik spricht man zunehmend von einer Zeitenwende: nichts ist mehr so wie wir es gewohnt waren. Disruption, Trendbrüche und Krisen sind in den verschiedenen Umwelten zu beobachten und damit wird die Zukunft komplexer und Investitionen mit höheren Risiken verbunden. Wir raten den Einfluss verschiedener Szenarien auf Businesspläne zu evaluieren und sich mit resilienten Strategien auseinanderzusetzen. Denn die Zukunft wird meist anders als man sie sich wünscht.